Warum wird sie Frankenstein genannt?
Wissen
Die neue Corona-Variante trägt den Spitznamen „Frankenstein“. Was hat es damit auf sich?
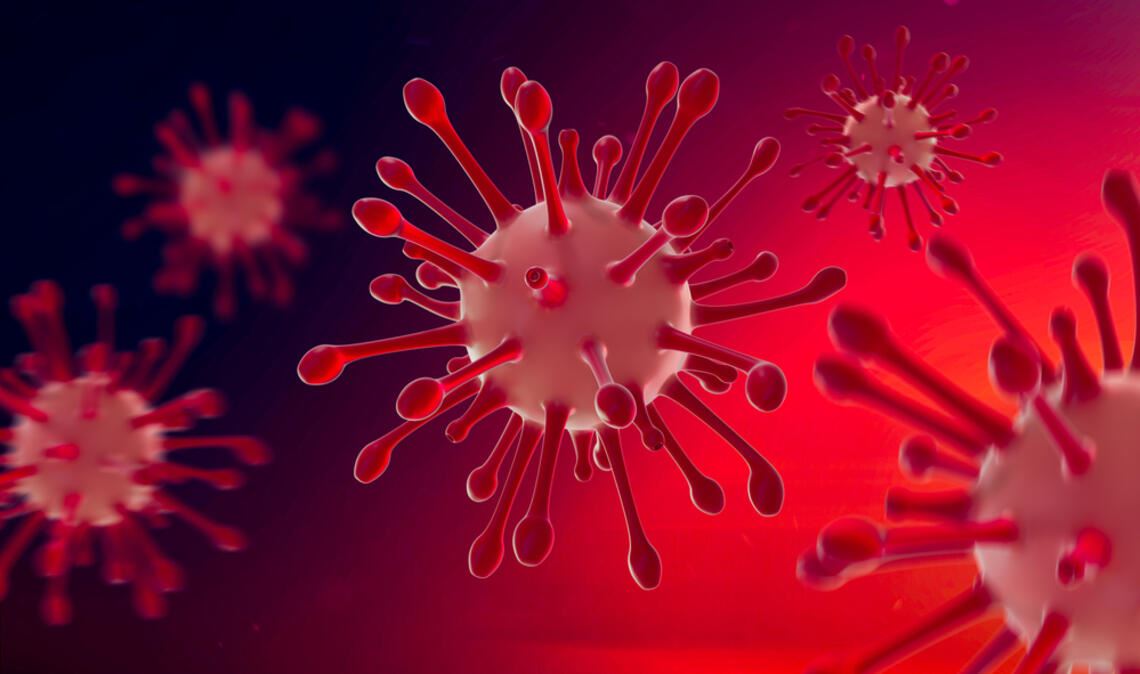
Woher kommt der Name "Frankenstein-Corona"?
(Foto: MIA Studio / shutterstock.com)
Von Lukas Böhl
Seit Beginn der Pandemie hat das Coronavirus immer wieder neue Varianten hervorgebracht. Die jüngste Linie, offiziell bekannt unter dem Namen Stratus (XFG), ist inzwischen weltweit dominant und sorgt auch in Deutschland für den Großteil der Infektionen. Medien sprechen von einer „Frankenstein-Variante“. Was steckt hinter dieser Bezeichnung?
Woher der Name „Frankenstein?“
Den Spitznamen „Frankenstein“ erhielt die Corona-Variante Stratus nicht, weil sie gefährlicher wäre und die Menschen zu Untoten macht, sondern wegen ihres genetischen Profils. Die Variante ist ein Mischprodukt aus Mutationen verschiedener Omikron-Subvarianten. Schon bei Omikron im Jahr 2021 hatte der südafrikanische Virologe Alex Sigal den Begriff „Frankenstein“ geprägt, um das außergewöhnlich komplexe Mutationsmuster zu beschreiben. Das Bild blieb hängen: ein Virus, das wie aus unterschiedlichen „Teilen“ zusammengesetzt wirkt.
Frankenstein-Corona: Welche Symptome treten auf?
Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe. Infektionen mit Stratus ähneln denen der bisherigen Omikron-Linien: Fieber, Husten, Halsschmerzen, Abgeschlagenheit und andere typische Symptome einer Atemwegsinfektion. Auch die Sterblichkeit ist nicht höher als bei anderen Varianten. Die WHO führt Stratus zwar auf ihrer Liste der „Varianten unter Beobachtung“, sieht aber – wie auch das RKI – kein erhöhtes Risiko für die öffentliche Gesundheit.
Schützen die Impfungen noch?
Die Frankenstein-Variante weist eine leicht stärkere Immunflucht auf, das heißt, Antikörper erkennen das Virus etwas schlechter. Dennoch gehen Experten davon aus, dass die zugelassenen Impfstoffe weiterhin gut vor schweren Verläufen schützen. Erste Labordaten und Tierstudien stützen diese Einschätzung.
Funktionieren die Schnelltests noch?
Ja. Corona-Schnelltests reagieren in der Regel auf das sogenannte Nukleokapsid-Protein. Dieser Bereich des Virus hat sich bei Stratus kaum verändert. Fachleute gehen deshalb davon aus, dass die Tests eine Infektion nach wie vor zuverlässig erkennen.

